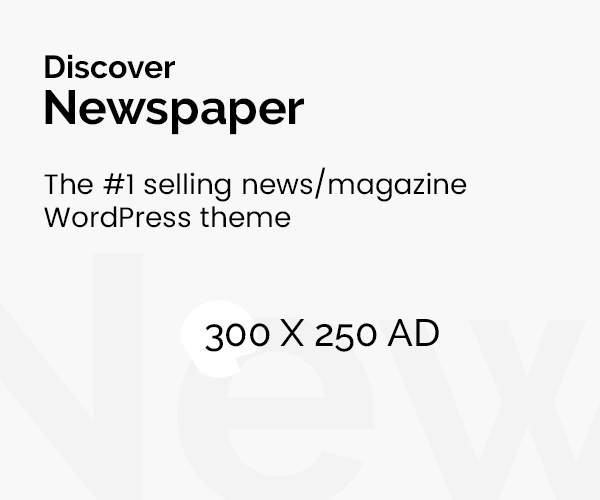„Was gibt es denn bei Ihnen an Weihnachten zu essen, Herr Özdemir?“ In diesen Tagen kommt fast kein Interview ohne diese Frage aus. Zugegeben, es ist nicht gerade weltbewegend, was ein Bundesminister am 24. Dezember isst.
Aber darum geht es bei dieser Frage eigentlich nicht. Es geht um etwas Anderes. Essen dient natürlich zuerst einmal unserem eigenen Überleben, klar. Darüber hinaus verbindet Essen uns, und Essen stiftet Identität. Essen ist Genuss und Tradition.
Doch Essen ist noch viel mehr. Denn nicht jeder Tisch ist gleich reichhaltig und gleich gut gedeckt. Neben Vorlieben und Gewohnheiten beeinflussen auch Einkommen und Bildung, was wir essen und welche Lebensmittel wir uns überhaupt leisten können. Unser Essen ist nicht einfach nur alltägliche Energiezufuhr – in ihm spiegeln sich auch ungleiche Lebenschancen und Lebenserwartungen.
Als Kind türkischer Gastarbeitereltern war ich häufiger auf mich allein gestellt, da meine Eltern im Schichtdienst gearbeitet haben. Nach der Schule waren sie noch nicht zu Hause. Die Schule war eine Halbtagsschule, und Mittagessen sollten die Kinder zu Hause einnehmen. Denn die Politik war darauf ausgerichtet, dass die Mama zu Hause als Hausfrau das Essen zubereitete und am Nachmittag über die Hausaufgaben schaute.
Wer kein warmes Essen vorfand, hatte eben Pech. Ich musste also die Mittagszeit, in der mein Magen knurrte, irgendwie überbrücken. Jeden Tag bekam ich abgezähltes Geld, um mir nach der Schule etwas zu essen zu kaufen – Currywurst mit Pommes. Natürlich schmeckte es mir auch.
Aber so oft? Es war halt schnell zugänglich und bezahlbar. Vielleicht hätte es auch Abwechslungsreicheres und damit auch mal was Gesünderes gegeben, aber daran habe ich keinen Gedanken verschwendet. Es ging mir schlicht darum, einfach und günstig satt zu werden. Für viele ist es heute noch so.
Deutsche Tafeln verzeichnen Anstieg um 50 Prozent
Noch nie haben die Tafeln in Deutschland so vielen bedürftigen Menschen geholfen wie zurzeit. Insgesamt kämen etwa zwei Millionen Menschen. Gleichzeitig seien die Lebensmittelspenden zurückgegangen.
Quelle: WELT
Geschadet hat es mir vermutlich nicht, hoffe ich jedenfalls. Aber im Nachhinein – auch mit zunehmendem Bewusstsein, dass Essen nicht gleich Essen ist – hat mich diese Erfahrung sensibilisiert: Wie wir uns ernähren, ist auch eine soziale Frage. Lord Ralf Dahrendorf hat es in einem Gespräch über Chancengleichheit einst auf den Punkt gebracht: „Eine Bildungsrepublik kann am Mittagessen scheitern“. Essen entscheidet mit über faire Lebenschancen.
Auch in einem reichen Land wie Deutschland gibt es Ernährungsarmut. In einkommensschwächeren Haushalten kommt weniger Vielfalt auf den Tisch. An Obst und Gemüse wird gespart, um Lebensmittel zu kaufen, die schneller satt machen.
Krisen wie die Covid-19-Pandemie, der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine und die damit verbundenen Preissteigerungen verschärfen das Problem. Zwischen 2018 und 2022 ist die Zahl der Menschen, die die Tafeln regelmäßig nutzen, von rund 1,5 Millionen Menschen auf mehr als zwei Millionen angestiegen.
Dürfen unsere Verantwortung für gesunde Ernährung nicht außer Acht lassen
Wir dürfen es nicht akzeptieren, dass Menschen sich gezwungenermaßen monoton ernähren müssen. Es darf keine Utopie bleiben, dass es für alle Menschen in Deutschland möglich und einfach ist, sich gut und nachhaltig zu ernähren – unabhängig von Einkommen, Bildung oder Herkunft. Es hat auch etwas mit Wertschätzung zu tun, wenn hart arbeitende Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sich darauf verlassen können, in der Kantine jederzeit gutes Essen zu bekommen.
Es sollte selbstverständlich sein, dass Patienten in Krankenhäusern das für ihre Genesung bestmögliche Essen bekommen. Und denken wir an unsere Kinder, an das Wertvollste, was wir haben: Sollte es nicht das Normalste der Welt sein, dass sie an Kitas und Schulen täglich gutes, leckeres Essen auf dem Teller haben – gerade dort auch ungeachtet ihrer sozialen Herkunft?
Das alles klingt ambitioniert? Ja, das ist es. Aber es wäre fatal, wenn wir unsere Verantwortung ignorieren würden, wenn es um Menschen mit Fehl- oder Mangelernährung oder Menschen in armutsgefährdeten Haushalten geht. Oder unsere Pflichten gegenüber Kindern vergessen, von deren Ideen und Kreativität es maßgeblich abhängt, wie unsere gemeinsame Zukunft auf diesem Planeten aussehen wird.
Wir tun uns als Gesellschaft selbst einen großen Gefallen, wenn alle Kinder gut essen können. Und gut essen heißt, sich auch gegen die Currywurst entscheiden zu können, weil gute schmackhafte Alternativen zur Verfügung stehen. Und weil gute Alternativen bekannt und gewohnt sind. Erst dann ist es tatsächlich eine echte Wahl für jeden und jeden.
Als Bundesregierung erarbeiten wir deshalb mit vielen Akteuren eine gemeinsame Ernährungsstrategie. Die Eckpunkte dazu werden wir heute im Bundeskabinett beschließen. Es geht, einfach gesagt, um die Frage, wie sich Jung und Alt durch bewusstes Essen, aber auch Sport und Bewegung gesund und fit halten können. Das gilt für das Frühstück zu Hause genauso wie für das Mittagessen in der Kantine.
Wir wollen auch da genauer hinschauen, wo unsere Verantwortung für eine gesunde Ernährung am wichtigsten ist. Bei unseren Kita- und Schulkindern braucht es abwechslungsreiche und gesundheitsfördernde Essensangebote. Sie sollen die Chance haben, von Kindesbeinen an zu lernen, dass gesund, lecker und nachhaltig auf dem Teller gut zusammenpassen.
Wer diesen Text bis hier gelesen hat, könnte denken: „Hat der sie noch alle – was ich esse, das entscheide ich und ich ganz allein.“ Ich würde antworten: Genau so ist es, was Sie essen, entscheiden Sie ganz allein – aber nicht jeder, der schlecht isst, will es auch oder ist selbst dran schuld. Es geht uns um bessere Möglichkeiten für alle. Das ist meine Motivation, nicht nur der Bundesminister für Ernährung zu sein, sondern der Minister für gutes Essen.
Es muss uns gelingen, Maß und Mitte, Genuss und Freude am Essen zusammenzubringen. Nicht mit dem moralischen Zeigefinger – es gehört zum Leben dazu, auch mal über die Stränge zu schlagen –, sondern aus Respekt gegenüber uns selbst und unseren Kindern. Für ein Leben, in dem man gesund alt werden kann – unabhängig von unserer sozialen Herkunft.
Cem Özdemir (Grüne) ist seit einem Jahr Bundeslandwirtschaftsminister. Bis 2018 war er für zehn Jahre Co-Vorsitzender der Grünen. Der 56-jährige Schwabe ist der erste Bundesminister, dessen Eltern aus der Türkei eingewandert sind.
„Alles auf Aktien“ ist der tägliche Börsen-Shot aus der WELT-Wirtschaftsredaktion. Jeden Morgen ab 5 Uhr mit den Finanzjournalisten von WELT. Für Börsen-Kenner und Einsteiger. Abonnieren Sie den Podcast bei Spotify, Apple Podcast, Amazon Music und Deezer. Oder direkt per RSS-Feed.